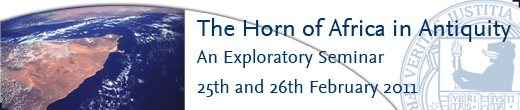The Horn of Africa in Antiquity
In diesem Artikel: Bildergalerie , Programm (PDF) , Bericht (PDF)
|
|
|
Bericht: Dipl.-Jur. Hatem Elliesie, MLE (Arbeitskreis Äthiopistik / Seminar für Semitistik und Arabistik an der Freien Universität Berlin) |
|
Am 25. und 26. Februar 2011 fand im Clubhaus der Freien Universität Berlin die internationale Tagung „The Horn of Africa in Antiquity: An Exploratory Seminar“ statt. Hierzu wurden vom Arbeitsbereich „Historische Geographie des antiken Mittelmeerraums“ (Prof. Dr. Klaus Geus) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fachdisziplinen aus dem In- und Ausland eingeladen, die zum Horn von Afrika in der Antike forschen. Zu den Zielen gehörte es, die zunehmende Spezialisierung und die damit einhergehende Fragmentierung der Forschungslandschaft zu überwinden. Bewusst sollten Fachleute aus ganz unterschiedlichen Disziplinen ins Gespräch gebracht werden, um gemeinsame Forschungsperspektiven, den Einsatz von neuen Methoden und Fragestellungen und den Forschungstand zu erörtern. Beteiligt waren Fachleute aus der Klassischen Archäologie und Sudanarchäologie, der Klassischen Philologie, der Semitistik und Äthiopistik, der Historischen Geographie und Alten Geschichte, der Byzantinischen Kunst und der Ägyptologie. Geleitet wurde das sog. Exploratory Seminar von Klaus Geus, der in der Moderation von Hatem Elliesie (Freie Universität Berlin) unterstützt wurde. Nach der Begrüßung und Einführung des Gastgebers referierte Monika Schuol (Freie Universität Berlin) zu: „Soqotra – Drehscheibe für Fernhandel und Kulturtransfer vor dem Horn von Afrika?“ Sie ging dabei der Frage nach, ob Soqotra als Drehscheibe des maritimen Fernhandels fungierte oder ob die Insel eher eine Nebenrolle in der Antike spielte. In einem multiperspektiven Zugang, bei dem sie u.a. neugefundene indische Inschriften und archäometrische Daten berücksichtigte, schlussfolgerte Schuol abschließend, dass aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten Soqotras diese Frage eher im Sinne einer Marginalisierung zu beantworten sei. Mit seinem Beitrag „Language Script and Society in South Arabia and on the Horn of Africa“ lieferte anschließend Rainer Voigt (Freie Universität Berlin) eine beeindruckende Zusammenfassung seiner langen Forschungsarbeit. Eine seiner These, wonach die Umbildung der semitischen Konsonantenschrift zur äthiopischen „Silbenschrift“ eher auf indischem Kultureinfluss, dem Malayalam, beruhe und weniger auf meroitischen Einfluss zurückzuführen sei, wurde anschließend ausgiebig diskutiert und bewertet. Francis Breyer (Universität Wien) und Peter Nadig (Freie Universität Berlin) widmeten sich dem Horn von Afrika aus einem pharaonischen beziehungsweise ptolemäischen Blickwinkel. Breyer ging in seiner Präsentation „Pharaonic Egypt and the Horn of Africa“ auf die alte Frage nach der Lokalisierung von Punt ein. Mit Hilfe von neuen linguistischen, ikonographischen und archäologischen Argumenten plädierte Breyer für die Gleichsetzung von Punt mit Abessinien. Außerdem schlug er für mehrere puntische Eigennamen und Toponyme kuschitische Wurzeln vor. Peter Nadig ging in seinem Vortrag „Hunting for Elephants: How the Ptolemies Kept Up with the Seleucids“ im ersten Teil auf die Elefantentransportwege vom Horn nach Ägypten ein. Anhand eines bisher unpublizierten Brotstempels mit Elefantenmotiv aus dem British Museum gelang es ihm, die besondere Rolle von Koptos herauszuarbeiten. Im zweiten Teil diskutierte Nadig die Funktion der Elefanten im ptolemäischen „Propagandakrieg“ mit den Seleukiden. Gianfranco Fiaccadori (Università degli studi di Milano) ging in seinem Referat „Aksum, the Red Sea, and Long-distance Trade in Pre-Islamic Times“ der Frage nach dem Gründen vom „Decline and Fall“ des Reiches von Axum nach. Anhand von bisher kaum berücksichtigten altäthiopischen, altsüdarabischen und arabischen Quellen zog er auf verschiedenen Ebenen Parallelen zwischen dem Niedergang Axums und dem gleichzeitigen Aufstieg des Islams. So sei durch die Umleitung der Handelsströme der lebensnotwendige Fernhandel nach Indien und in die Mittelmeerwelt erschwert worden. Fiaccadori blieb aber nicht bei der in der bisherigen Forschung dominierenden ökonomischen These stehen, sondern unterzog weitere Faktoren – etwa den sassanidischen und byzantinischen Einfluss auf die Arabische Halbinsel – in seine Bewertung mit ein. Einen ebenso umfassenden wie kritischen Überblick über die Quellen und Forschungsliteratur zur griechischen und altäthiopischen Hagiographie lieferte Alessandro Bausi (Universität Hamburg) in seinem Vortrag „The Ethiopic Sources on the 6th Cent. Events at Najran Once More“. Von besonderer Bedeutung ist Bausis „Wiederentdeckung“ eines äthiopischen Manuskripts, das ohne arabische Zwischenstufe aus dem Griechischen übersetzt wurde und das wertvolle Informationen zur Geschichte des 6. Jahrhunderts n. Chr. enthält. Veronica Bucciantini (Deutsches Archäologisches Institut, Berlin) diskutierte in ihrem Vortrag „The Limits of Knowledge: Explorations and Information from the Horn of Africa to the African East Coast in the Greco-Roman Tradition from the 2nd Century BC” die Rezeption und Transformation von geographischen Begriffen in der griechischen Literatur. Von besonderer Bedeutung erwies sich dabei das bereits im Fahrtbericht des Karthagers Hanno (um 500 v. Chr.) erwähnte „Notou Keras“ („Horn des Südens“), das auf die Vorstellungen der antiken Geographen, etwa Strabons, zu Afrika und insbesondere zum Horn von Afrika starken Einfluss nahm. An den Vortrag von Bucciantini knüpfte Serena Bianchetti in ihrem Beitrag „Das Horn von Afrika in den Geographika des Eratosthenes“ an. Sie schälte aus dem Text des Strabon die unterschiedlichen Angaben der griechischen Geographen – Philon, Eratosthenes, Agatharchides, Artemidor u.a. – bezüglich des Roten Meeres bzw. des Horns von Afrika heraus. Die Vorstellung und Benennung eines „Horn des Südens“ an der Ostküste Afrika bildete offenbar einen zentralen Streitpunkt zwischen den Geographen. Vor allem durch die Interpretation eines ptolemäischen Graffitos gelang es Bianchetti, der quaestio vexata neue Aspekte und Einsichten abzuringen. Aus seiner aktuellen Arbeit an einer Edition und Kommentierung des Periplus Maris Erythraei stellte Didier Marcotte (Université de Reims) einige Ergebnisse vor. Mehrere Korrupteln konnte er durch eine sorgfältige Beachtung der geographischen Terminologie des Logbuchs (Mitte des 1. Jh. n. Chr.) heilen. Die große Ähnlichkeit zwischen den Angaben des Periplus, des Ptolemaios und des Markianos im Bezug auf topographische Angaben zum Horn legen eine Abhängigkeit bzw. einen gemeinsamen Quellenfundus nahe. In der Diskussion des Vortrags „Auf den Straßen Azaniens: Das Horn von Afrika im Periplus des Roten Meeres“ wurde besonders die Rolle des Indienfahrers Diogenes, der im Handbuch des Ptolemaios genannt wird, erörtert. Pierre Schneider (Université d’Artois) schließlich stellte in seinem Vortrag „The Bab el-Mandeb in Greco-Roman Times: Experience, Knowledge and Propaganda“ die verschiedenen Angaben antiker Autoren über die südliche Meerenge des Roten Meeres vor. Die vielen, teilweise stark abweichenden Varianten (etwa auch bei den Entfernungsangaben) führte er auf verschiedene Modi der Wahrnehmung und Repräsentation der antiken Autoren und Reisenden zurück. Schneider unterschied daher plausibel zwischen einer geographischen, einer chorographischen und einer periplografischen Raumerfassung. Die intensiven Diskussionsrunden zeigten, dass die Ziele des „Explora-tory Seminars“ – die verschiedenen Disziplinen wieder mehr ins Gespräch zu bringen – erfüllt worden sind. Dem Ruf nach Berlin folgte neben den Referentinnen und Referenten |
Bildergalerie Programm (PDF) Bericht (PDF) gehe zurück